

Ortschaft in Ostfriesland, seit 1237


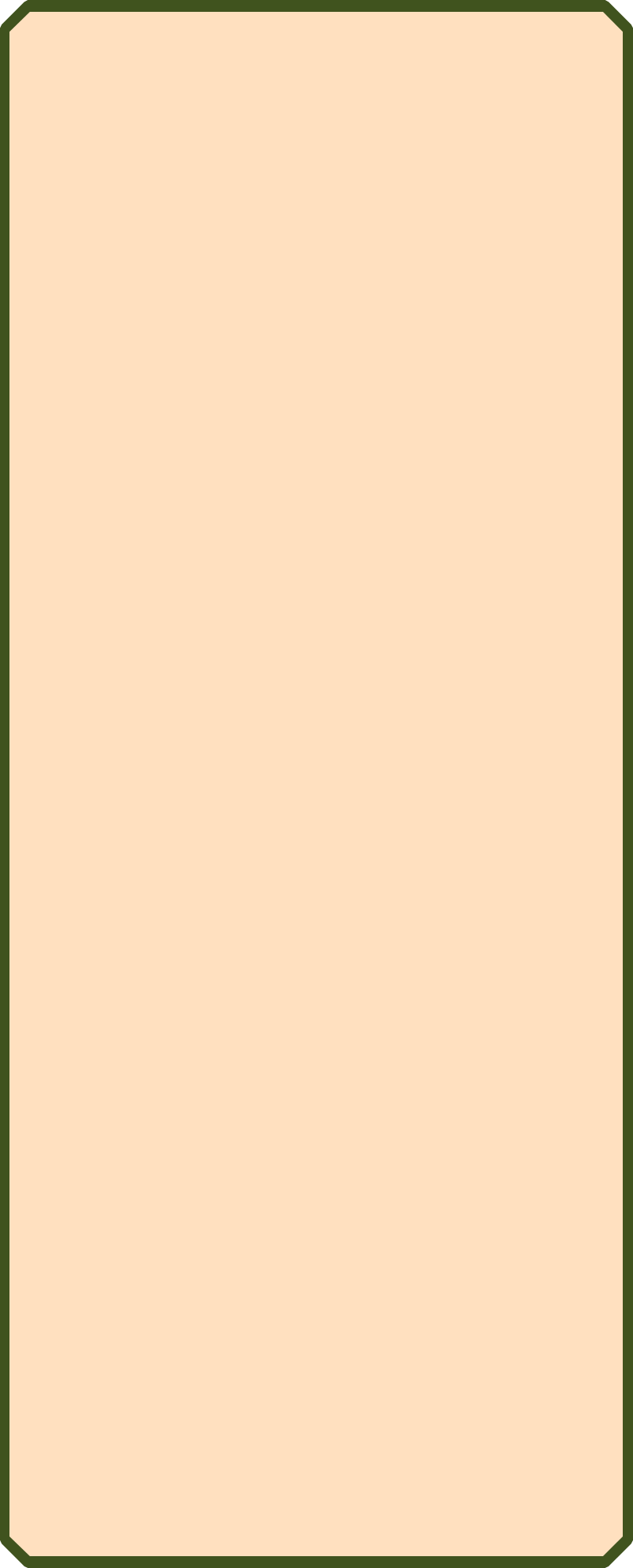
DIE ALLGEMEINE ENTWICKLUNG NACH 1945
Die Eggelinger, die als Wehrmachtsangehörige den Krieg überlebt hatten, kamen zum großen Teil schon 1945 zurück.
Einige blieben jedoch noch jahrelang in feindlichem Gewahrsam und kamen erst 1948 und 1949 wieder.
Insbesondere, wenn sie in russischer Gefangenschaft gewesen waren, hatten sie Schweres durchmachen müssen.
Der Flüchtlingsstrom riß auch mit Ablauf des Jahres 1945 nicht ab. Immer noch kamen Vertriebene aus den
ehemaligen deutschen Ostgebieten östlich der Oder, aus Polen oder aus dem Sudetenland. Ihr Hab und Gut hatten
sie zurücklassen müssen und brachten nur das mit, was sie am Körper trugen und in Koffern und Rucksäcken tragen
konnten. Für ihre Unterbringung mußte die Gemeinde sorgen. Der Bürgermeister und seine Gemeinderäte hatten
damals einen sehr schweren Stand. Die Bevölkerung unserer Gemeinde wuchs sprungartig von etwa 360 auf über
500 Personen. Auf vielen Höfen waren die Flüchtlinge als Arbeitskräfte willkommen, denn nach dem Abzug der
Fremdarbeiter und Kriegsgefangenen gab es wieder einen Bedarf an Mitarbeiter, zumal die eigenen Leute zum Teil
noch nicht zurück waren.
Aber auch im Dorf gab es nur wenig Häuser, in die keine Flüchtlinge 'eingewiesen wurden. Hier auf engbegrenztem
Raum war es oft schwierig, miteinander auszukommen. Die Flüchtlinge waren nicht überall willkommen. Wo es nötig
war, mußte die Wohnungsbehörde beim Landkreis einschreiten und eine Zwangseinweisung vornehmen. Im
allgemeinen hatten die Einheimischen für die Not der Flüchtlinge jedoch Verständnis. Man rückte zusammen und
machte Platz und war froh, nicht selbst aus der Heimat vertrieben zu werden.
Um den Rechten der Vertriebenen und Flüchtlinge mehr Nachdruck zu verschaffen, wurden aus ihrer Mitte
Flüchtlingsbetreuer gewählt, die ihren Leidensgenossen in ihrer schwierigen Lage behilflich waren und bei der
Unterbringung und Versorgung den Gemeinden mit Rat und Tat zur Seite standen. In Eggelingen war Hans Steege,
Vertriebener aus Pommern, jahrelang Flüchtlingsbetreuer.
Um der Wohnungsnot Herr zu werden, ließ die Gemeinde schließlich provisorische Notunterkünfte bauen. So wurde
neben der Kirche, wo sich jetzt der Bolzplatz befindet, eine Wellblechbaracke, eine sogenannte Nissenhütte, errichtet.
Jahrelang haben darin Menschen gewohnt. In Greehörn, gegenüber dem Hof Siebels, wurden zwei Holzbaracken
aufgestellt, in denen lange Zeit mehrere Familien wohnten. Insgesamt waren die Wohnverhältnisse katastrophal und
aus heutiger Sicht vielfach menschenunwürdig.
Im übrigen herrschte Mangel an allen Ecken und Enden. Lebensmittel gab es nach wie vor nur auf Marken, und alle
anderen Bedarfsgüter des täglichen Lebens waren für Geld nicht zu bekommen. Wer etwas zu tauschen hatte, war
noch glücklich dran und konnte sich das beschaffen, was ihm fehlte. In Wittmund waren eigens Tauschzentralen
eingerichtet worden. Die Flüchtlinge und Vertriebenen waren jedoch weitgehend auch von diesem Geschäft
ausgeschlossen, denn sie hatten ja kaum das Nötigste mitgebracht. Um eine Selbstversorgung mit Kartoffeln und
Gemüse sicherzustellen, stellte die Kirche das gesamte jetzige Gebiet "Lange Land" als Gartenland zur Verfügung.
Interessierte Pächter waren mehr als genug da. Auch das gesamte Gebiet der jetzigen Eggelinger Siedlung wurde als
Gartenland genutzt; die Häuser wurden hier erst später gebaut.
Ein besonderes Problem war die Beschaffung von Brennmaterial. Kohlezuteilungen gab es kaum. Wer nicht frieren
wollte, mußte selbst Torf graben, eine schwere Arbeit, die mancher erst erlernen mußte. Das Grabegebiet der
Eggelinger befand sich im Collrunger Moor. Während der Grabezeit im Mai und später zum "Stuken" und "Bülten" des
Torfes wurde täglich ein Lkw eingesetzt, um die Leute nach Collrunger Moor zu bringen. Um möglichst viel zu
schaffen, schlugen einige dort auch ein Zelt auf und blieben nachts dort.
Tabak und Zigaretten waren in den Jahren nach dem Krieg ebenfalls eine Mangelware. Wer als Nichtraucher seine
Zuteilung nicht selbst verbrauchte, hatte ein wertvolles Tauschobjekt. Wer im Garten noch ein Plätzchen frei hatte,
baute zwischen Kohl und Kartoffeln seine eigenen Tabakpflanzen an. Nach der Ernte wurden die reifen Blätter
aufgereiht und in Schuppen und Scheunen getrocknet. Da zu Anfang niemand Erfahrung mit der Herstellung von
Tabak hatte, gab es viele Versuche, ein möglichst schmackhaftes Kraut herzustellen. Die einen zerkleinerten die
Blätter einfach mit einem Messer, Fortgeschrittene hatten sich eine Schneidemaschine zugelegt und besprengten die
Blätter vorher mit Zuckerwasser. Welche Mühe man sich aber auch machte, die Qualität von Spitzentabak hat dieser
Eigenbau wohl nie erreicht.
Auch in der Herstellung von Schnaps aus Rüben versuchten sich einige und waren dabei sehr erfinderisch bei der
Herstellung des nötigen Geräts, insbesondere der Destilliervorrichtung. Wer beim Schnapsbrennen erwischt wurde,
mußte damit rechnen, von dem britischen Militärgericht bestraft zu werden.
Die Hauptsorge war natürlich die Beschaffung von Lebensmitteln, insbesondere von Fleisch, Speck und Fett. Viele
hatten die Möglichkeit, ein Schwein schlachten zu können. Da dieses aber auf die amtliche Fleischzuteilung
angerechnet wurde, wurde so manches Schwein "schwarz" geschlachtet, ein Delikt, das aus der Not geboren wurde;
denn man mußte ja überleben.
Mit der Währungsreform am 20.06.1948 wurde die Deutsche Mark eingeführt. Jede Person erhielt ein sogenanntes
Kopfgeld von 40,00 Deutsche Mark. Jetzt konnte man für Geld wieder alles kaufen. Die Bewirtschaftung der
Lebensmittel und aller anderen Güter wurde aufgehoben. Doch das Geld war knapp und die Arbeitslosigkeit groß.
Die Vertriebenen bekamen in den folgenden Jahren für ihr verlorenes Vermögen bescheidene
Entschädigungszahlungen nach dem Lastenausgleichsgesetz. Aber für alle gab es hier keine Arbeit. Viele
Vertriebenen packten daher erneut ihre Koffer und ließen sich auf Staatskosten in andere Gebiete der Bundesrepublik
umsiedeln, z. B. nach Nordrhein-Westfalen oder nach Südwestdeutschland, wo neue Industrien aufgebaut und
Arbeitskräfte gesucht wurden.
Aber auch bei uns machte sich das Wirtschaftswunder langsam bemerkbar. Die Verhältnisse besserten sich. Die
Notunterkünfte verschwanden nach und nach. Mit Hilfe günstiger Darlehen aus öffentlichen Mitteln, teilweise aus dem
Lastenausgleichsfond, konnten sich Vertriebene, aber auch Einheimische Häuser bauen.
So entstanden nach und nach von Anfang der fünfziger Jahre und in den sechziger Jahren die Eggelinger und die
Greehörner Siedlung. Noch nie sind in Eggelingen in so kurzer Zeit so viele Häuser gebaut worden. Auf Bestreben
des Bürgervereins beschloß die Stadt Wittmund 1982 einen Bebauungsplan für das Baugebiet Lange Land, wo in den
folgenden Jahren ebenfalls mehrere Häuser gebaut wurden, aber noch eine reichliche Zahl an Bauplätzen angeboten
wird.
Über den Strukturwandel in der Landwirtschaft und den damit verbundenen Verlust von Arbeitsplätzen in diesem
Wirtschaftszweig haben wir bereits geschrieben. Die frei gewordenen Arbeitskräfte konnten weitgehend anderweitig
Beschäftigung finden, z. B. bei den Olympiawerken in Roffhausen, dem Rehau-Werk in Wittmund oder auch bei der
Bundeswehr.
Im Zuge dieser Entwicklung gelang es auch, die hier verbliebenen Vertriebenen und Flüchtlinge wirtschaftlich und
sozial einzugliedern. Die Älteren unter ihnen wurden versorgt durch eine Rente nach dem Lastenausgleichsgesetz.
Viele sind inzwischen gestorben und wurden hier auf dem Friedhof begraben. Sie haben ihre Heimat nicht
wiedergesehen. Die Jüngeren fanden Arbeit, verheirateten sich teilweise mit Einheimischen. Inzwischen gibt es den
Unterschied zwischen Einheimischen und Vertriebenen nicht mehr. Die Letzteren gehören längst zur
Dorfgemeinschaft.
Trotz vieler moderner Errungenschaften, die das Leben der Menschen erleichtern und verschönern, kann man die
Entwicklung in den letzten Jahrzehnten nicht uneingeschränkt gutheißen.
Die Zeiten, da unsere Landgemeinde mit ihren Höfen und Gewerbebetrieben eine wirtschaftliche Einheit bildete, wo
man die meisten Bedarfsgüter des täglichen Lebens erwerben konnte, sind vorbei. Man trifft sich jetzt beim Einkauf in
der Fußgängerzone in Wittmund.
Wer berufstätig ist und nicht gerade einen landwirtschaftlichen Betrieb bewirtschaftet, verdient seinen
Lebensunterhalt auswärts und hält sich nur außerhalb seiner Arbeitszeit hier am Ort auf.
Vieles, was früher ein Dorf mitprägte, der Gemeinderat, das Bürgermeisteramt, die Schule, Läden, Handwerksbetriebe
und Wirtshäuser, wurde aufgelöst, geschlossen, aufgegeben. Wenn man bedenkt, daß in diesen Einrichtungen
gearbeitet wurde und die Menschen hier ihren Lebensunterhalt verdienten, daß sie Stätten der Begegnung waren und
die Gemeinde mit Leben füllten, kann man ermessen, daß unser Dorf ärmer geworden ist. Aber es bringt nichts,
vergangenen Zeiten nachzutrauern.
Wir haben ja noch unsere Kirchengemeinde mit dem Frauenkreis, dem Kindersingkreis und dem Posaunenchor. Und
es gibt hier den Boßeler- und Klootschießerverein, den Bürgerverein und die Feuerwehr, und nicht zu vergessen die
Jagdhornbläser, die Theatergruppe und die "Bude".
Wenn alle diese Einrichtungen, Vereine und Gruppen aktiv bleiben und von der Bevölkerung unterstützt und gefördert
werden, dann kann in Eggelingen eine lebendige Dorfgemeinschaft auch weiterhin bestehen.


















